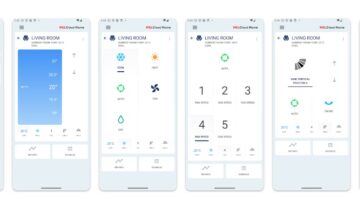In Willich am Niederrhein wurde die Modernisierung zweier Mehrfamilienhäuser aus den 1960er-Jahren zum Musterbeispiel für energieeffizientes Wohnen. Die umfassende Sanierung kombiniert die Erneuerung der Gebäudehülle mit moderner Heiztechnik. Im Mittelpunkt steht eine Hybridlösung aus Wärmepumpe und Gas-Brennwertkessel, die den Energieverbrauch deutlich reduziert und den Wohnkomfort steigert.

Ausgangslage: Hoher Verbrauch und veraltete Technik
Vor der Sanierung wurden die zwölf Wohnungen der beiden Gebäude dezentral über Gas-Kombithermen beheizt. Die Jahresverbräuche lagen trotz Wohnflächen zwischen 46 und 72 Quadratmetern bei rund 90.000 Kilowattstunden. Hauptursachen waren eine unzureichende Dämmung, Zweifachverglasung, ineffiziente Heizgeräte und fehlende Wärmerückgewinnung. Auch der Schallschutz war unzureichend – ein typisches Problem vieler Bauten dieser Zeit.
Die Kombination aus hohen Verbräuchen, veralteter Technik und steigenden Energiekosten führte zu einer schlechten Energiebilanz. Zudem war die dezentrale Versorgung wartungsintensiv und verursachte höhere Kosten pro Wohnung.
Maßnahmen: Gebäudedämmung, Fenstererneuerung und neue Heiztechnik
Die Sanierung umfasste eine vollständige energetische Aufwertung der Gebäudehülle. Außenwände, Dach und Kellerdecke erhielten eine neue Dämmschicht, um Wärmeverluste zu minimieren. Der Austausch der alten Fenster gegen moderne Dreifachverglasung verbesserte nicht nur die Energieeffizienz, sondern auch den Lärmschutz.
Das Herzstück bildet die Umstellung auf ein zentrales Hybridsystem. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 14 Kilowatt thermischer Leistung deckt den überwiegenden Teil des Wärmebedarfs. An sehr kalten Tagen unterstützt ein Gas-Brennwertkessel. Der gemessene Effizienzwert, die Jahresarbeitszahl von 2,76, bestätigt den hohen Wirkungsgrad. Ergänzt wurde das System um einen hydraulischen Abgleich, neue Heizkörper, einen Pufferspeicher mit Frischwasserstation und die zentrale Warmwasserbereitung.
Ergebnis: KfW-85-Standard erreicht, Betriebskosten gesenkt
Durch die Modernisierung sank der spezifische Heizenergieverbrauch von zuvor deutlich über 200 auf rund 129 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Die Vorlauftemperatur der Heizung liegt nun bei 55 statt zuvor bis zu 79 Grad Celsius. Beide Gebäude erfüllen den KfW-Effizienzhaus-85-Standard. Für die Bewohner bedeutet dies geringere Heizkosten und ein spürbar verbessertes Raumklima.
Neben der Energieeinsparung verbessert die neue Technik auch die Betriebssicherheit. Die zentrale Anlage ist leichter zu warten, und die gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt für einen höheren Wohnkomfort.
Herausforderungen und Projektumsetzung
Wie bei vielen Bestandsmodernisierungen mussten technische Anpassungen an bestehende Strukturen erfolgen. Die Integration der Wärmepumpe erforderte präzise Planungen, da der Platz in den Heizungsräumen begrenzt war. Auch die Koordination der Dämmarbeiten und der Heizungsumstellung mit den Mietern war ein wesentlicher Faktor. Durch frühzeitige Information und eine transparente Kommunikation konnte die Akzeptanz der Bewohner gesichert werden.
Ein weiterer Punkt war die Abstimmung der energetischen Maßnahmen aufeinander: Die verbesserte Dämmung reduzierte den Heizwärmebedarf, sodass die Wärmepumpe effizienter arbeiten kann. Die Anpassung der Hydraulik stellte sicher, dass Heiz- und Warmwasserversorgung optimal funktionieren.
Kosten, Förderung und Wirtschaftlichkeit
Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 1,25 Millionen Euro. Die Installation der Wärmepumpe und die Einbindung ins System kosteten etwa 34.000 Euro. Fördermittel der KfW und des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) halfen, die Investitionslast zu verringern. Langfristig profitieren sowohl Eigentümer als auch Mieter von geringeren Energiekosten und einer höheren Gebäudewertigkeit.
Bedeutung für die Wärmewende
Das Projekt zeigt, dass Wärmepumpentechnologie auch in Mehrfamilienhäusern wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll einsetzbar ist – besonders in Verbindung mit einer umfassenden energetischen Sanierung. Hybridsysteme können dabei eine Brückenlösung sein, um fossile Energieträger schrittweise zu ersetzen und dennoch Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Empfehlungen für ähnliche Projekte
Eigentümer und Wohnungsbaugesellschaften sollten einen detaillierten Sanierungsfahrplan erstellen, um technische Maßnahmen und Fördermöglichkeiten optimal aufeinander abzustimmen. Förderprogramme von KfW und BAFA können einen erheblichen Beitrag zur Finanzierung leisten. Die Einbindung qualifizierter Fachbetriebe ist entscheidend für die Qualität der Umsetzung. Regelmäßiges Monitoring der Anlageneffizienz hilft, die Betriebskosten dauerhaft niedrig zu halten und die Klimaziele zu unterstützen.