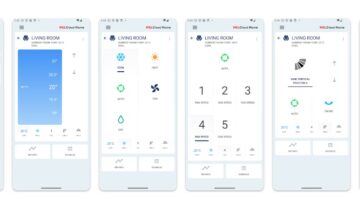Fernwärme ist effizienter und umweltschonender als ein eigener Heizkessel. Im neuen Heizungsgesetz spielt sie eine wesentliche Rolle.

Nach den Daten des Zensus (Volkszählung) wurden 2022 rund 15 Prozent der 43,1 Millionen Wohnungen in Deutschland mit Fernwärme beheizt. Mit 56 Prozent dominiert Gas, gefolgt von Heizöl mit 19 Prozent. Wärmepumpen beheizen nur 3 Prozent der Wohnungen.
Das neue Gebäudeenergiegesetz schreibt für alle Neubauten, für die ab Januar 2024 ein Bauantrag gestellt wird, Heizungen mit einem 65-Prozent-Ökoanteil vor. Bestehende Heizungen dürfen weiterbetrieben werden, auch wenn sie kaputt gehen und repariert werden können. Ist ein Austausch der Heizung notwendig, sind weiterhin Heizungen, die mit Gas oder Öl betrieben werden, erlaubt – zumindest bis in dem Ort, in dem das Gebäude steht, eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Darin wird festgelegt, ob das Haus an ein Wärmenetz angeschlossen werden kann oder der Eigentümer sich selbst kümmern muss.
Vor allem in eng bebauten städtischen Regionen soll so künftig klimafreundlich geheizt werden. Allerdings steht die Fernwärme im Ruf, eine vergleichsweise teure Heizart zu sein. Die Reform der Fernwärmeverordnung (AVBFernwärmeV) soll das ändern. Anbieter sollen zukünftig Informationen darüber veröffentlichen wie ihre Preise zustande kommen, auf welche Kosten sich ein Durchschnittshaushalt einstellen muss und warum Preise geändert werden.
Das Grundproblem bei der Fernwärme ist: Die Verbraucher sind an den Anbieter gebunden, der in ihrem Wohnort das Rohrsystem betreibt, das heißes Wasser als Heizenergie in die Häuser bringt. Erzeugt wird die Fernwärme oft noch mit Kohle oder Gas. In Zukunft sollen verstärkt grüne Energieträger wie Erdwärme genutzt werden.
Übergangsfristen für Erdgas und Öl
Der Wärmeplan muss in Großstädten (über 100.000 Einwohner) bis zum 30. Juni 2026 vorliegen, überall sonst Mitte 2028. Hat die Kommune bereits einen Wärmeplan, ist der Einbau von Heizungen mit 65 Prozent erneuerbaren Energie verbindlich. 2023 wurde die Hälfte aller Wohnungen in Deutschland mit Erdgas beheizt. Auf Platz 2 liegt die Ölheizung. Nur knapp über 10 Prozent aller Wohnungen werden mit Fernwärme beheizt und mit warmem Wasser versorgt.
Wird das Fernwärmenetz ausgebaut, verpflichten Städte Hauseigentümer, die eine bestehende Heizung ersetzen, häufig dazu, sich anschließen zu lassen. Ausnahmen vom Anschlusszwang gibt es, wenn etwa mit einer Wärmepumpe klimafreundlich geheizt wird.
Die Vorteile des Energieträgers Fernwärme im Vergleich zu Erdgas und Heizöl liegen vor allem bei den Kosten. Dieses Heizungskonzept ist in seiner Anschaffung und Wartung sehr einfach und wirtschaftlich effizient. Der Verbraucher benötigt keinen eigenen Kessel und keine Wärmepumpe zu Hause, lediglich eine Übergabestation, die günstiger ist als eine neue Heizung. In den Fernwärmenetzen werden alle verfügbaren Energieträger verwertet, vor allem Kohle, zunehmend aber auch erneuerbare Energien wie Solarthermie und Geothermie. Alle neu gebauten und geförderten Fernwärmenetze müssen einen Ökoanteil von mindestens 75 Prozent haben.
Nach den Zahlen der Plattform CO2-Online, die jedes Jahr Tausende Betriebskostenabrechnungen auswertet, war im Jahr 2022 für eine 70-Quadratmeter-Wohnung Fernwärme die günstigste Heizart mit Betriebskosten von 1.015 Euro. Eine Wärmepumpe schlug mit 1.260 Euro zu Buche, eine Gasheizung mit 1.475 Euro. In den Vorjahren war dagegen das Heizen mit Fernwärme am teuersten. Die Preise für Fernwäme je nach Region sind deutlich unterschiedlich.
Wie funktioniert Fernwärme?
Geheizt wird zentral: Ein großer Heizkessel versorgt eine ganze Siedlung oder einen Kiez in der Großstadt. Die Fernwärme kann dabei von Blockkraftwerken und Heizkraftwerken stammen, wo sie als Nebenprodukt der Stromerzeugung anfällt, aber auch aus großen Industriebetrieben, Müllverbrennungsanlagen und Kläranlagen. Die dort entstehende Wärme wird über ein wassergefülltes Rohrleitungssystem in die angeschlossenen Häuser geliefert. Weil dabei Wärme auf dem Transport verlorengeht, lässt sich Fernwärme meist nur lokal bis maximal 20 Kilometer liefern. Sie lohnt sich daher am meisten in dicht besiedelten Gebieten, wo iauf einer geringen Fläche viele Haushalte versorgt werden können.
Der Verband kommunaler Unternehmen hat kürzlich von der Beratungsgesellschaft Prognos schätzen lassen, wie viel der Ausbau der Fernwärmenetze kosten wird: 43,5 Milliarden Euro bis 2030. Die Studie geht davon aus, dass bis 2045 14 Millionen Wohnungen mit Fernwärme versorgt werden, also mehr als doppelt so viele wie heute.
Überhöhte Abrechungen
Die Vergangenheit hat gezeigt: Zu überhöhten Fernwärmeabrechungen kann es kommen, wenn Stadtwerke einen zu hohen Wärmebedarf als Anschlusswert zu Grunde legten. Die Stadtwerke richten dann Leistungskapazitäten für derart kalte Winter ein, dass sie auch für Temperaturen ausreichen könnten, wie sie in Sibirien (minus 50 Grad) herrschen. Die überhöhten Anschlusswerte würden dann im so genannten leistungsabhängigen Grundpreis abgerechnet, den der Kunde zahlen müsse, egal ob er tatsächlich viel oder wenig Fernwärme für Heizung und Warmwasser verbraucht. Wenn Kunden sich beschwerten, wird nicht selten der Anschlusswert nach unten korrigiert und die Rechnung fallen niedriger aus.
Mitunter sind Fernwärmepreise auch an die Gaspreisentwicklung gekoppelt, obwohl kein oder nur sehr wenig Gas verfeuert wird.
Generell gilt: Dass die lokalen Anbieter, die das Netz aufbauen, zumeist Monopolisten sind und keinen Wettbewerb zu befürchten haben, hat negative Auswirkungen auf den Preis. Fehlende Transparenz und eine schwer nachvollziehbare Preisbildung sind seit Jahren die Hauptkritikpunkte von Verbraucherschützern.
Was ist Nahwärme?
Nahwärme funktioniert so wie Fernwärme: Die Wärme wird in einer zentralen Anlage erzeugt und erreicht die Haushalte durch ein Leitungssystem – als heißes Wasser. Bei Nahwärme liegen Erzeugungsanlage und Haushalt nah beieinander, bei Fernwärme nicht. Eine Biogasanlage kann eine solche Erzeugungsanlage sein: Sie verbrennt Methan und treibt somit einen Motor an, der Motor erzeugt Strom und Wärme, die Wärme erhitzt Wasser, das Wasser fließt in die Haushalte des Nahwärmenetzes. Dort erhitzt es in einer speziellen Anlage das Heizwasser und Trinkwarmwasser.