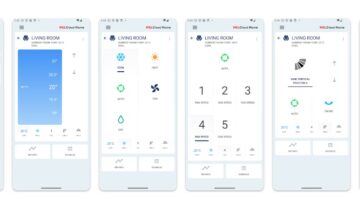Immer mehr Kommunen in Deutschland bauen ihre Fernwärmenetze aus. Für Hauseigentümer kann das gravierende Folgen haben. Denn mit dem Ausbau wird häufig auch der sogenannte Anschluss- und Benutzungszwang (ABZ) eingeführt. Doch was bedeutet das konkret? Und können Eigentümer sich dagegen wehren?

Fernwärme gilt als platzsparende und wartungsarme Heizlösung. Die Energie wird zentral erzeugt und über isolierte Leitungen in die Haushalte transportiert. Besonders umweltfreundlich ist das System, wenn es mit erneuerbaren Energien oder industrieller Abwärme betrieben wird. Das Gebäudeenergiegesetz schreibt sogar vor, dass neue Netze künftig zu mindestens 65 Prozent klimaneutral sein müssen.
Doch mit der Einführung der Fernwärmeversorgung in Städten und Gemeinden geht häufig ein ABZ einher. Das bedeutet: Hauseigentümer müssen nicht nur einen Anschluss an das Netz ermöglichen, sondern auch ausschließlich die Fernwärme zur Beheizung ihrer Immobilie nutzen.
Rechtliche Grundlagen: Wer entscheidet über den Zwang?
Entgegen der weit verbreiteten Annahme ist der Anschluss- und Benutzungszwang keine bundesweit einheitliche Regelung. Ob ein Zwang besteht, entscheiden die Kommunen selbst. Grundlage sind die jeweiligen Gemeindeordnungen der Bundesländer. In Neubaugebieten ist ein Anschluss an das Wärmenetz meist bereits im Bebauungsplan vorgesehen. Für Bestandsgebäude gelten in der Regel Übergangsfristen oder Ausnahmen.
Wer bereits eine klimafreundliche Heizung wie eine Wärmepumpe oder eine Pelletanlage betreibt, kann sich oft auf eine Ausnahmeregelung berufen. Laut AVB-Fernwärmeverordnung ist ein anderer regenerativer Wärmeerzeuger dann zulässig, wenn er mindestens genauso umweltfreundlich ist wie die örtliche Fernwärme.
Kritik von Verbraucherschützern
Verbraucherschützer sehen die Praxis kritisch. Florian Munder vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) warnt vor einem Monopol der Fernwärmeanbieter. Die Vertragsbedingungen seien oft einseitig, und Kunden hätten weniger Rechte als bei anderen Heizformen. „Die Wahlfreiheit der Verbraucher wird dadurch unnötig eingeschränkt“, so Munder.
Tatsächlich sei es jedoch in der Praxis selten, dass Kommunen den ABZ konsequent durchsetzen. Ein aktuelles Gutachten der Energie- und Klimaschutzagentur Niedersachsen kommt zudem zu dem Ergebnis, dass der Ausschluss anderer klimafreundlicher Heizsysteme rechtlich kaum haltbar sei.
Pflicht mit Spielraum
Der Ausbau der Fernwärme kann eine sinnvolle Maßnahme zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung sein. Für Hauseigentümer ist es jedoch wichtig, genau zu prüfen, ob und in welchem Umfang ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht. In vielen Fällen bestehen Ausnahmeregelungen, etwa bei vorhandenen klimafreundlichen Heizsystemen. Kommunale Satzungen und eine fundierte Beratung sind entscheidend, um Klarheit zu gewinnen.